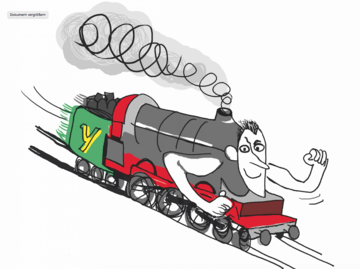Ausmisten oder das zweite Leben der Cordhose

Unser Autor hat versucht, auszumisten – aber es geht nicht. Er ist ein Sachenbehalter. Das soll sich ändern, weshalb er sich ein Vorbild an seinem Mitbewohner nimmt, für ein schlankes Feng-Shui-Leben.
Ich stehe vor meinem Kleiderschrank und rede mit meinen Cordhosen. Ich habe eine hell- und eine dunkelbraune: beide spektakuläre Fehlkäufe. Über Monate hab ich versucht sie anzuziehen. Es geht nicht. Ich sehe in Cordhosen aus wie ein Erdkundelehrer, der in Geschäften den Fahrradhelm auflässt und nach Wurstbrotdose riecht. Trotzdem kann ich mich nicht von ihnen trennen. „Cordhosen, wie geht’s euch?“ Irre. Ich spreche mit Klamotten. Wie konnte es so weit kommen?
Seit Jahren lebe ich in zwei Städten: vier Tage die Woche mit Freundin und Sohn in Berlin; drei Tage in Hamburg, der Arbeit wegen – wo ich eine Miniwohnung mit Nils teile, einem Meeresbiologen. Vor Kurzem sind wir gemeinsam umgezogen. Nils hat sein Zimmer mit kleinen Schlauberger-Kunstobjekten und wenigen gebundenen Büchern eingerichtet, das war’s. Es sieht aus wie der Stahlrohrsessel-Wartebereich einer Augenlaserpraxis in Düsseldorf – meines wie eine Jugendzimmermüllkippe mit Lichterkette. Ich bin neidisch. Nils hat sein Leben im Griff, ich habe mein Leben in Pappkartons. Aus denen Fotos, LPs und große Teile der H & M-Kollektionen von 2005 bis 2010 herausquellen. Das muss aufhören. Ich miste aus, ich will auch so ein schlankes Feng-Shui-Leben.
Ich hab wirklich probiert, Dinge wegzuschmeißen. Ich kann’s nicht. Ich bin ein Sachenbehalter. Nicht weil ich geizig oder sentimental bin. Sondern für den Notfall. Was, wenn mich eine Grippe ans Bett nagelt und ich die Zeit finde, nochmal alle Harry-Potter-Ausgaben zu lesen und frühe „Was ist was“-Bände? Was, wenn ich den Wunsch verspüre, mein Abi-’92-T-Shirt zu tragen – und die Ersatz-Skistiefel, die ich seit drei Umzügen mitschleppe? Ich besitze auch ein Ersatz-Waffeleisen. Überhaupt eine Menge Dinge, die mit dem Wort „Ersatz“ anfangen. Ich bin ausgestattet wie ein Schweizer Messer. Trotzdem fühlt sich der Sachenbehalter in Gegenwart des Wegschmeißers mies, aus der Mode geraten. Ihn umweht der Muff der analogen, alten Welt. Nils hat einen Laptop, der rechtwinklig auf seinem Schreibtisch steht. Ich könnte durchdrehen.
Um Nils’ Klugscheißerblicken zu entgehen, habe ich mit dem Ausmisten auf dem Dachboden begonnen. Hat super geklappt. Bis ich innerhalb von Minuten das Verhalten entwickelt habe, das man von einem Vierjährigen kennt, der abends seine Tierfiguren aufräumen soll. Er räumt nicht auf, er spielt. Ich habe jetzt statt zwei Tüten mit Schallplatten eine große, neu sortierte Kiste mit Schallplatten. Dabei habe ich nicht mal einen Plattenspieler. Als ich vom Dachboden kam, fühlte ich mich wie ein Weight Watcher, der in Nutella gebadet hat. Schuldig. Und glücklich.
Mit der Aura des moralisch Überlegenen hat Nils mir zwei Aufräum-Ratgeber geschenkt: so, wie man miefenden Pubertierenden Deo schenkt. Mein Lieblingsbuch ist von Marie Kondo. Laut Kondo soll man sich fragen, wie sich die Klamotten im Schrank fühlen. Tja. Speziell meinen Cordhosen geht’s – nicht gut. Die hatten sich das Leben anders vorgestellt, bunter, mehr Action, einfach cordhosiger. Ich war kurz davor, eine aus Mitleid anzuziehen; wegschmeißen kann ich sie jetzt auf keinen Fall mehr. Das zweite Buch empfiehlt, Dinge nicht wegzuwerfen, sondern zu verschenken. Man fühle sich leichter, besser und – ich sage es mal in meinen Worten – tut Leuten einen Gefallen, die nicht so scharfen Retro-Kram wie ich besitzen.
Und tatsächlich, es funktioniert. Ich habe einen Karton mit Skischuhen, Waffeleisen, Cordhosen gepackt. Und Nils geschenkt. Er hat sich auf leise, aufgeräumte Feng-Shui-Art gefreut, die vermutlich nach innen strahlt. Der Dachboden sieht schon viel besser aus. Und wenn ich Kram vermisse, weiß ich ja, wo ich ihn finden kann.